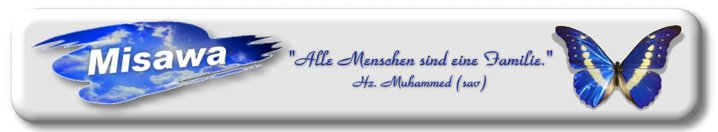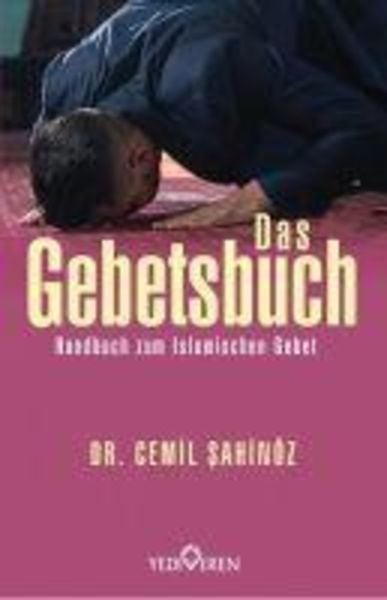



Alle Aktivitäten
Dieser Stream aktualisiert sich automatisch
- Gestern
-

Camii, Tekke, Medreseye, kurumlara zekat verilirmi?
Webmaster antwortete auf Legend Killer's Thema in Dini konular
Kur’an kursuna zekat istediler, versem bir sıkıntı olur mu? Zekat fakir Müslüman’ın hakkıdır. İslam uğruna iş görüyor olsalar bile kurumlara zekat verilemez. Kursta netice de bir kurumdur. Kur’an’a hizmet ediyor olması bu hükmü değiştirmez. Bu başlığı, KUR’AN KURSU TALEBESİNE şeklinde değiştirmemiz durumunda ise mümkündür. Çünkü talebe bireydir, zekat bireyin hakkıdır. Nureddin Yıldız -

Camii, Tekke, Medreseye, kurumlara zekat verilirmi?
Webmaster antwortete auf Legend Killer's Thema in Dini konular
Zekât âyetinde geçen “fî sebîlillâh”ın kapsamına okullar, Kur’ân kursları, camiler ve benzeri hayır kurumları girer mi? Zekâtın sarf yerleri, Kur’ân-ı Kerîm’de (et-Tevbe, 9/60) belirlenmiştir. Hz. Peygamber (s.a.s.)de toplanan zekâttan kendisine hisse verilmesini isteyen bir zata hitaben, “Yüce Allah, zekât (taksimi) hususunda bir peygamberin veya başkasının hükmüne razı olmadı, onunla ilgili hükmü bizzat kendisi verdi ve onu sekiz sınıfa taksim etti. Eğer o sınıflardan isen sana hakkını veririm.” (Ebû Dâvûd, Zekât, 23 [1630]) buyurmuştur. Bu itibarla, belirli şartları taşıyan Müslümanların yükümlü oldukları zekât ve fıtır sadakasının, Kur’ân-ı Kerîm’de Cenâb-ı Hak tarafından belirlenen yerler dışında herhangi bir yere verilmesi veya cami, köprü, yol, okul, yurt, çeşme gibi yerlere sarf edilmesi caiz değildir. Zira zekât ve fıtır sadakasının sahih olmasının şartlarından biri de bunların zekât alması caiz olan gerçek kişilere temlik edilmesidir. İlgili âyetteki “Allah yolunda” anlamına gelen “fî sebîlillâh” ifadesi, orduyla birlikte savaşa gitmek istediği halde maddî imkân bulamayan mücahitleri içermektedir. Hac yoluna çıkıp fakir duruma düşen hac yolcularını da bu kapsamda değerlendirenler vardır. (el-Fetâva’l-Hindiyye, 1/188) Buna göre okullar, Kur’ân kursları, camiler ve benzeri hayır kurumları, zekât verilecek yerler bağlamında “fî sebîlillâh” kapsamına girmez. Din İşleri Yüksek Kurulu 12.03.2025 -

Camii, Tekke, Medreseye, kurumlara zekat verilirmi?
Webmaster antwortete auf Legend Killer's Thema in Dini konular
Hastanelere alınan sağlık cihazları zekât yerine geçer mi? Zekâtın verilebileceği yerler Kur’ân-ı Kerîm’de ismen sayılarak belirtilmiştir. Bunlar; fakirler, yoksullar (miskinler), zekât toplamakla görevlendirilen memurlar, müellefe-i kulûb, hürriyetlerini elde etmeye çalışan köleler, borçlular, Allah yolunda cihad edenler (fî sebîlillah) ve yolda kalmış olanlardır. (et-Tevbe, 9/60) Bu âyette belirtilenler kurum değil, bireylerdir. Buna göre zekât bizzat bireye veya onun vekiline verilmelidir. Bu genel ilkeye göre adı ne olursa olsun kurumlara zekât verilmez. Âlimlerin çoğunluğunun görüşü bu istikamettedir. (Kâsânî, Bedâ’i, 2/43-46; İbnü’l-Hümâm, Fethu’l-kadîr, 2/272; İbn Kudâme, el-Muğnî, 2/497-498) Ancak halka hizmet veren bu gibi kurumlara gönüllü yardımlar yapılabilir. Din İşleri Yüksek Kurulu 12.03.2025 - Letzte Woche
-
- Früher
-
Zum Download: https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_mwoswo.Mahjong Dieses Spiel macht genau eine Sache – und die richtig gut: Es bringt Ihnen das klassische Mahjong-Solitaire-Erlebnis in einer klaren, modernen Version mit leicht verständlichen Symbolen. Finden Sie passende freie Paare, entferne die Steine und räume das Spielfeld strategisch ab. Wählen Sie zwischen Easy, Medium und Hard und bestehen Sie die Herausforderung, die Sie können. Warum dieses Spiel anders ist: ✅ Es ist komplett werbefrei. Kein Banner, keine Pop-ups, keine Unterbrechungen. ✅ Es ist familienfreundlich und kindgerecht gestaltet. Keine Gewalt, keine problematischen Inhalte. ✅ Es ist bewusst klar und übersichtlich. Keine überladenen Menüs, kein unnötiger Ballast. ✅ Es funktioniert ohne Registrierung. Einfach starten und spielen. Perfekt für: ✅ Kurze Denkpausen zwischendurch. ✅Gemeinsames Spielen in der Familie. ✅ Entspannung nach Schule oder Arbeit. ✅ Alle, die klassischen Puzzle-Spiele lieben. Starten. Kombinieren. Gewinnen. Ganz ohne Ablenkung.
-
https://youtu.be/6wBDkIQ40lU